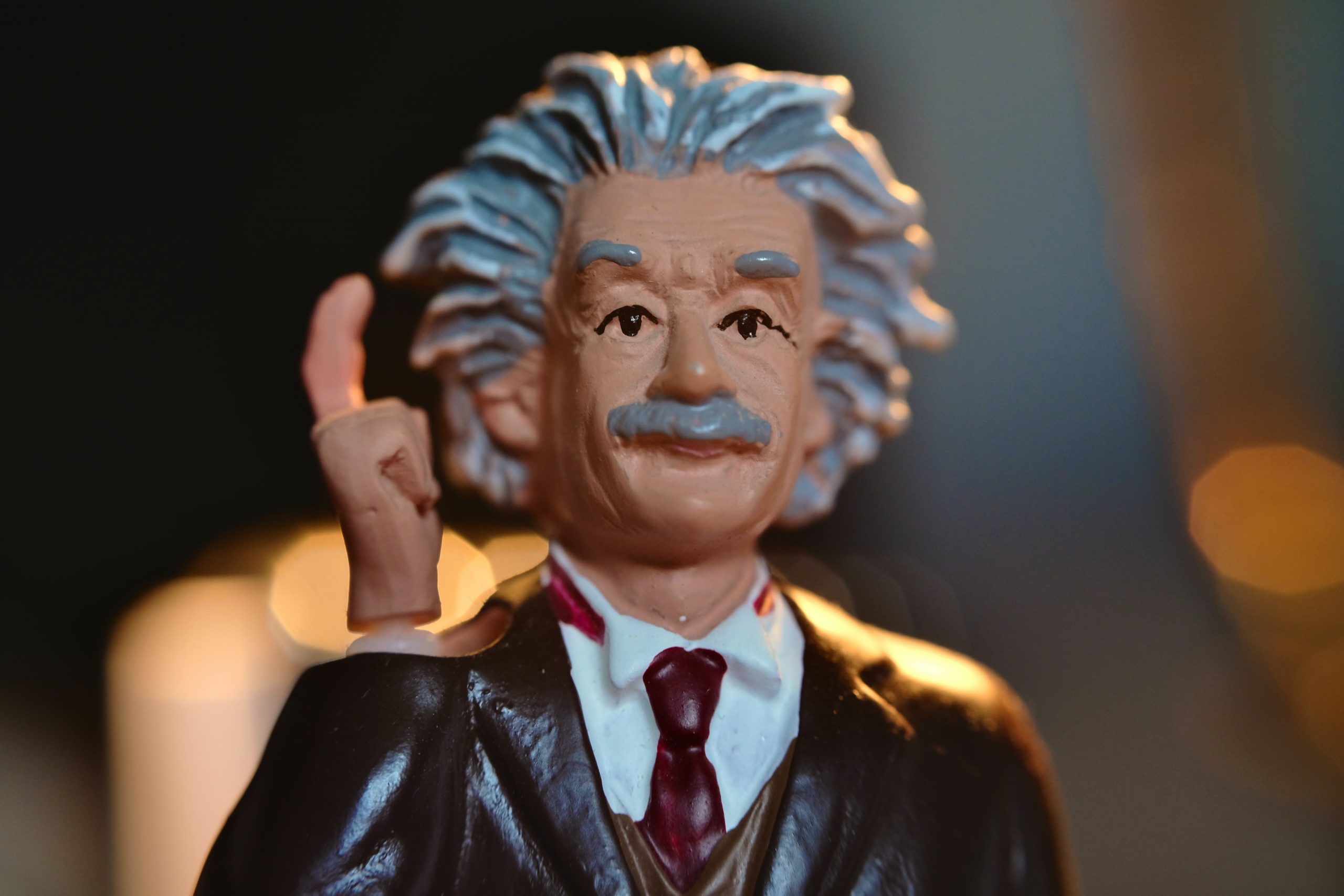Die zunehmende Integration von KI-gestützten Tools in den täglichen Gebrauch führt zu tiefgreifenden Veränderungen im digitalen Ökosystem. Zwei prominente Beispiele sind ChatGPT von OpenAI und die Google Search Generative Experience. Beide werfen bedeutende Fragen zur Nutzung und zum Schutz von Inhalten auf, wie die jüngsten Entwicklungen bei der New York Times und Google zeigen.
Die New York Times hat neulich ihre Crawling-Vorgaben aktualisiert und sowohl den CommonCrawl-Webindex als auch den OpenAI-Webcrawler ausgeschlossen. Dieser Schritt kam nach gescheiterten Verhandlungen mit OpenAI über die Nutzung ihrer Inhalte zustande. Einige Spekulationen deuten darauf hin, dass eine rechtliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien bevorstehen könnte.
Die Intention, Inhalte öffentlich im Internet zur Verfügung zu stellen, war immer klar:
Sie generieren Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit, was wiederum zu monetären Vorteilen für den Anbieter führt.
Doch die Integration künstlicher Intelligenz in Suchmaschinen und Web-Crawler stellt dieses bisher unausgesprochene Abkommen in Frage. Tools wie die Google Search Generative Experience benötigen keinen direkten Besuch auf der Webseite, um den Inhalt anzuzeigen, da die KI die Arbeit für den Nutzer übernimmt. Dies führt zu einem erheblichen Problem, insbesondere aus der Perspektive der Webseitenbetreiber:
KIs klicken nicht auf Anzeigen oder schließen Abonnements ab.
Trotz der Einführung von Google-Extended, einem neuen Tool, das Webseitenbetreibern erlaubt, Google darüber zu informieren, ihre Inhalte nicht für bestimmte KI-Projekte wie Bard und Vertex AI zu nutzen, gibt es einen Haken. Dieses Tool schützt Inhalte nicht vor der Nutzung in der Search Generative Experience (SGE).
Google erklärt, dass die SGE ein integraler Bestandteil der Google-Suche ist und nicht einfach ein aufgesetztes Feature. Daher sollten Webseitenbetreiber weiterhin den Googlebot über die robots.txt und den NOINDEX-Meta-Tag steuern. Beunruhigend ist, dass es Fälle gibt, in denen die SGE KI-generierte Antworten zeigt, obwohl die betreffenden Webseiten ausdrücklich verlangt haben, dass Google ihren Inhalt nicht für KI-Zwecke nutzt.
Für Webseitenbetreiber, die ihre Inhalte nicht in der SGE sehen möchten, bleibt nur eine radikale Option: Googlebot komplett zu blockieren. Ein Schritt, den nur wenige in Betracht ziehen würden.
Google argumentiert, dass KI und LLM schon seit Jahren im Zusammenhang mit der Google Suche eingesetzt werden und deren Suchergebnisse verbessern helfen.
Das Aufkommen von KI-Tools wie ChatGPT und die Google Search Generative Experience führt zu einem Paradigmenwechsel in der digitalen Landschaft. Während sie Nutzer:innen innovative und effiziente Lösungen bieten, stellen sie Webseitenbetreiber:innen vor komplexe Herausforderungen hinsichtlich Urheberrecht und Monetarisierung. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Konflikt entwickelt und welche Kompromisse in der Zukunft gefunden werden.